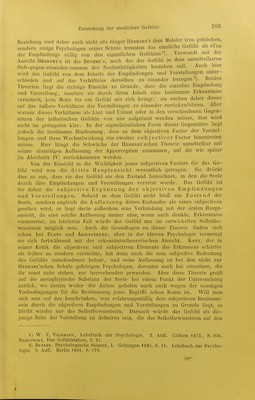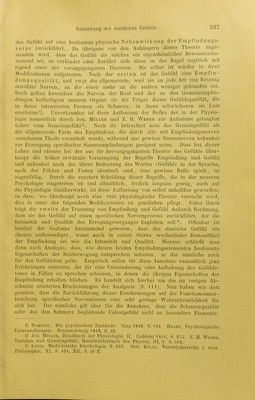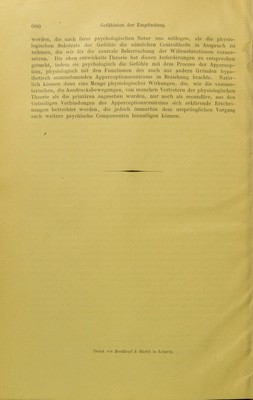Volume 1
Grundzüge der physiologischen Psychologie / von Wilhelm Wundt.
- Wundt, Wilhelm Max, 1832-1920.
- Date:
- 1893
Licence: Public Domain Mark
Credit: Grundzüge der physiologischen Psychologie / von Wilhelm Wundt. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by King’s College London. The original may be consulted at King’s College London.
616/624 (page 598)
![sondern an eine eigenthiiinliche, in gewissem Grade isolirbare Eigenschaft der Nervenelemcnte überhaupt gebunden sei. Vielmehr weisen gerade die Er- scheinungen der so genannten Analgesie auf centrale Bedingungen verwickel- tcrer Art hin. Dazukommt noch, dass, wie oben ausgeführt, die physischen Begleiterscheinungen des Gefühls ohne eine umfangreiche Mitbetheiligung des Centraiorgans, die auf die Centren der Athmung, der Blutgefäßinnervation, des Herzens herübergreift, nicht erklärlich sind. Damit werden wir von selbst zu der dritten Modification der physiologischen Theorie hingeführt. Sie betrachtet das Gefühl als eine an bestimmte centrale Gehirnvorgänge gebundene Bewussiseinsqualilät. Ursprünglich ist diese Ansicht von der Beobachtung der äußerlich sichtbaren physiologischen Wirkungen der Gefühle und Affecle, der Ausdrucksbewegungen, ausgegangen. Die einfachste Art, wie diese für die Gewinnung einer rein physiologisclien Theorie der Gefühle verwerthbar zu sein schienen, war die, dass man das von der splritualistischen Psychologie in der Regel angenommene Causalverhältniss zwischen den Gefühlen und ihrem Ausdruck in Aflect- und Triebbewegungen einfach umkehrte: irgend ein Sinnes- reiz, sagte man, veranlasst durch eine centrale Reflexwirkung äußere Bewe- gungen, die von seiner Qualität und Intensität abhängig sind, diese Bewegungen verursachen aber Empfindungen in den Muskeln und in den andern am Ge- meingefühl betheiligten Organen, und diese Empfindungen sind es nun, denen wir je nach ihrer Beschaflenlieit den Charakter von Lust- oder Unlustgefühlen beilegen. »Wir weinen nicht«, wie W. James sagt, »weil wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen«!). Neben den Wirkungen auf die mimischen Muskeln legte man hierbei auf die Veränderungen der Athmungs- und Ilerzbewegungen sowie der Gefäßinnervation großes Gewicht. Speciell auf die letzteren^ auf die vasomotorischen Wirkungen der Reize suchte nament- lich C. Lange 2] alle Gefühle und Gemüthsbewegungen zurückzuführen. Die Verwandtschaft dieser Anschauungen mit der in der Lehre vom Gemeingefühl zum Ausdruck kommenden ersten Form der physiologischen Theorie springt in die Augen: auch hier sind es schließlich bestimmte Empfindungen der Muskeln, der Haut und einiger verwandter Empfindungsgebiete, die an und für sich, als eine nicht weiter zu erklärende Eigenthümlichkeit ihrer Qualität, den Lust- oder Unlustcliarakter haben sollen. Der einzige Unterschied liegt darin, dass man auf den centralen Ursprung dieser Empfindungen besonderen Werth legt. In dieser Betonung des, wenn auch nur indirect angenommenen, centralen Ursprungs der Gefühle liegt nun aber zugleich der Keim zu weiteren Umge- staltungen dieser Anschauung, die gegenüber den bis dahin betrachteten phy- siologischen Hypothesen einen gewissen Fortschritt bezeichnen. Sobald man nämlich nicht mehr auf die peripherischen Effecte der vasomotorischen oder sonstigen centralen Innervationswirkungen, sondern auf die centrale Beschatfen- heit derselben den Ilauptwerth legt, so liegt es nahe, dass man nun auch der specifischen Eigenthümlichkeit des Gefühls im Unterschiede von der Empfindung gerecht zu werden und insbesondere den Lust- oder Unlustcharakter desselben auf gegensätzliche centrale Innervationswirkungen zurückzuführen sucht, zu denen dann die äußeren Effecte auf Puls, Athmung und Blutgefäße sich nur 1) W. James, Mind 1884, p. 188. Psychology 4890. II, p. 442 ff. 2) C. Lange, Ueber Gemüthsbewegungen. Deutsch von H. Kurella, Leipzig 1 887. Vgl. dazu meine kritisclien Bemerkungen, Phil. Stud. VI, S. 349 fl'.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21293788_0001_0616.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)