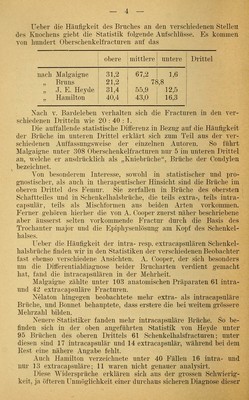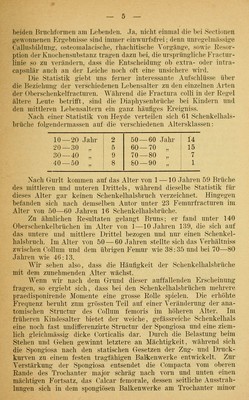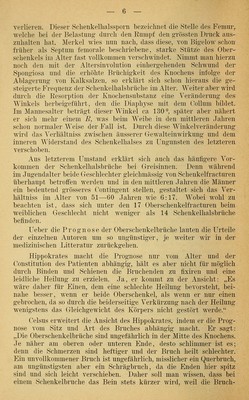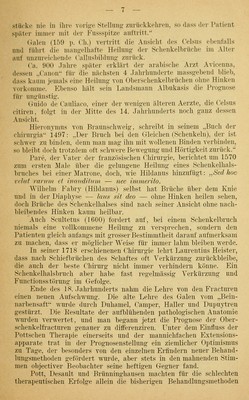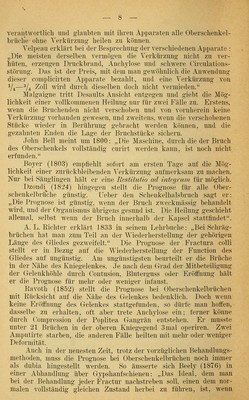Die Oberschenkelbruche und ihre Behandlungsmethoden.
- Hubler, Johannes Edmind.
- Date:
- [1895]
Licence: Public Domain Mark
Credit: Die Oberschenkelbruche und ihre Behandlungsmethoden. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by the Augustus C. Long Health Sciences Library at Columbia University and Columbia University Libraries/Information Services, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the the Augustus C. Long Health Sciences Library at Columbia University and Columbia University.
11/58 (page 7)
![stücke nie in ihre vorige Stellunt?- zuiückkeliren, so dass der Patient si»äter immer mit der Fiisssi)itze auftritt. (4alen (159 ]>. C'li.) vertritt die Ansieht des Celsus ebenfalls und führt die mangelhafte Heilung- der Schenkelhrüche im Alter auf unzureichende ('allushildung- zurück. Ca. 900 Jahre später erklärt der arabische Arzt Avicenna, dessen .,Canon für die nächsten 4 Jahrhunderte massgebend blieb, (hiss kaum jenuils eine Heilung von Oberschenkelbrüchen ohne Hinken vorkomme. Ebenso hält sein Landsmann Albukasis die Prognose für ungünstig-. Guido de Cauliaco, einer der wenigen älteren Aerzte, die Celsus citiren, folgt in der Mitte des 14. Jahrhunderts noch ganz dessen Ansicht. Hieronymus von Braunschweig, schreibt in seinem „Buch der chirurgia i497: „Der Bruch bei den Gleichen (Schenkeln), der ist schwer zu binden, denn man mag ihn mit wollenen Binden verbinden, so bleibt doch trotzdem oft schwere Beweg-ung und Hörtigkeit zurück. Pare. der Vater der französischen Chirurgie, berichtet um 1570 zum ersten Male über die gelungene Heilung- eines Schenkelhals- bruches bei einer Matrone, doch, wie Hildanus hinzufügt: „Seclhoc velut rarum et inandihnn — nee immerito. AMlhelm Fabry (Hildanus) selbst hat Brüche über dem Knie und in der Diaphyse — laus sit deo — ohne Hinken heilen sehen, doch Brüche des iSchenkelhalses sind nach seiner Ansicht ohne nach- bleibendes Hinken kaum heilbar. Auch Scultetus (1600) fordert auf, bei einem Schenkelbruch niemals eine vollkommene Heilung zu versprechen, sondern den Patienten gleich anfangs mit grosser Bestimmtheit darauf aufmerksam zu machen, dass er mög-licher AVeise für immer lahm bleiben werde. In seiner 1718 erschienenen Chirurgie lehrt Laurentius Heister, dass nach Schiefbrüchen des Schaftes oft Verkürzung zurückbleibe, die auch der beste Chirurg nicht immer verhindern könne. Ein Schenkelhalsbruch aber habe fast regelmässig Verkürzung und Functionsstörung im Gefolge. Ende des 18. Jahrhunderts nahm die Lehre von den Fracturen einen neuen Aufschwung. Die alte Lehre des Galen vom „Bein- narbensaft wurde durch Duhamel, Camper, Haller und Dupuji^ren gestürzt. Die Resultate der aufblühenden pathologischen Anatomie wurden verwertet, und man begann jetzt die Prognose der Ober- schenkelfracturen genauer zu differenziren. Unter dem Einfluss der Pottschen Therapie einerseits und der mannichfachen Extensions- apparate trat in der Prognosenstellung ein ziemlicher Optimismus zu Tage, der besonders von den einzelnen Erfindern neuer Behand- lungsmethoden gefördert wurde, aber stets in den mahnenden Stim- men objectiver Beobachter seine heftigen Gegner fand. Pott, Desault und Brünninghausen machten für die schlechten therapeutischen Erfolge allein die bisherigen Behandlungsmethoden](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21218109_0011.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)