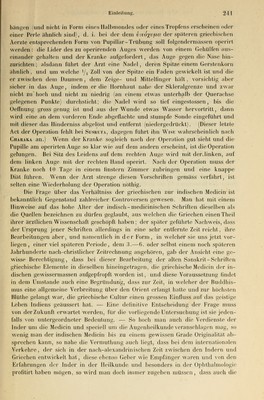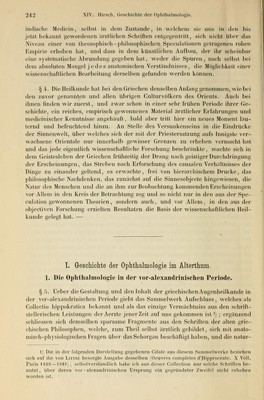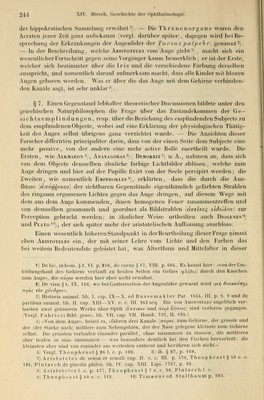Licence: Public Domain Mark
Credit: Geschichte der Augenheilkunde. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by the Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library at Yale University, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library at Yale University.
21/336 (page 243)
![historischen Werke des Aristoteles und seiner Nachfolger an. — Wenn auch nicht angenommen werden darf, dass diese Quellen die Summe alles ophthalmologischen Wissens jener Zeit enthalten, so gewähren sie doch einen vollkommenen Einblick in den Charakter der damaligen Augenheilkunde, welche uns als integrirender Theil der allgemeinen Heilkunde behandelt und mit derselben theoretisch und praktisch aufs Innigste verbunden entgegentritt und ein getreues Abbild des Charakters giebt, den die Medicin in dieser ersten Periode ihrer wissenschaft- lichen Entwickelung überhaupt trägt. §6. Ueber den anatomischen Bau des Auges besassen die ältesten grie- chischen Aerzle eine sehr geringe Kenntniss, die sich fast nur auf Dasjenige be- schränkte, was eine ganz oberflächliche Betrachtung des Organs lehrt; zudem wird das Verständniss ihrer Angilben hierüber noch dadurch erschwert, dass ihnen eine bestimmte Terminologie für die einzelnen Theile des Auges abging. — Sie unterscheiden drei das Auge umhüllende und schützende Häute1), eine äussere dickere (Sklera), eine mittle dünnere und eine dritte, besonders zarte, die Augenfeuchtigkeit umschliessende, welche insgesammt da, wo sie vordem sehenden Theile des Auges liegen, durchsichtig sind; mit dem Namen öxpig2) wird bald die Pupille (die an andern Stellen auch xögrj genannt wird5), bald die Cornea, bald die Iris bezeichnet, zuweilen dient das Wort auch zur Be- zeichnung des Sehvermögens im Allgemeinen. Innerhalb des Bulbus befinden sich die Augenfeuch tigkei ten, summarisch als zo vyQÖv aufgeführt, mit dem Bemerken'), »dass diese ursprünglich zähe (glutinöse) Feuchtigkeit, wenn sie aus dem geborstenen Auge hervortritt, flüssig bleibt, so lange sie warm ist, nach der Erkaltung aber fest wird und dann durchsichtigem Weihrauch ähnlich ist.« — Von einer Kenntniss der Linse findet sich in den Schriften der vor- alexandrinischen Zeit Nichts. — Erwähnenswerth ist die dem Alkmaeon , einem der ältesten pythagoräischen Philosophen, der sich nachweisbar ernstlich mit ana- tomischen resp. zootomischen Untersuchungen beschäftigt hat, von Chalci- dius5) und Diogenes Laertrs0) zugeschriebene Entdeckung der Nervi op- tici; eine bestimmte Angabe hierüber finden wir bei Theophrast 7), der aus der Alk maeon'sehen Lehre über die Sinneswahrnehmungen citirt: »so wie alle Sinne stehen auch die Augen mit dem Gehirne in Verbindung und zwar durch Kanäle (tiüqol), durch welche der sinnliche Eindruck zum Gehirne forlgeleitet wirdo8). — Auch die Arieria (oder Vena) ophthalm. wird an mehreren Stellen in 1) De locis in homine § 2, VI. p. 278, de carne § 17, VIII. p. 604. 2) De locis in homine § 13, VI. p. 302, de visu § 1, IX. p. 152, Epid. lili. IV. § 30, IV. p. 172, Prorrhet, lib. II. § 19, IX. p. 146 u. v. a. 0. 3) De carne und Prorrhet. II. cc. 4) De locis in hom. § 2 und de carne II. cc. 5) Comment. in Piatonis Timaeum. Lugd. Bat. 617, p. 340. 6) De vitis claror. philosoph. lib. VIII. cap. V. Colon. 616, p. 620. 7) De sensu et sensilibus fragmenlum in L. Philippson vh] av&Qwntvr). ßcrol. 1834, 26, p. 106. 8) Auch die Alexandriner haben diese Bezeichnung nbyoi für die Sehnerven beibehalten ; ihiss sie oder gar Alkmaeon diese Bezeichnung mit Rücksicht auf die den Nerv, opt. perfori- r ende Art. centralis gewählt haben, ist niebt wahrscheinlich, vermuthlicb sollte damit das Organ, im bildlichen Sinne, als Leitungskanal bezeichnet werden.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b2101999x_0021.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)