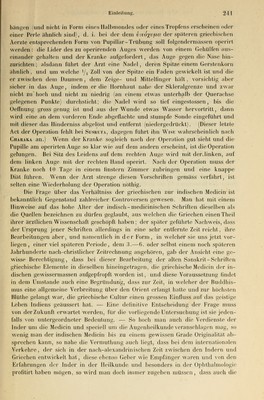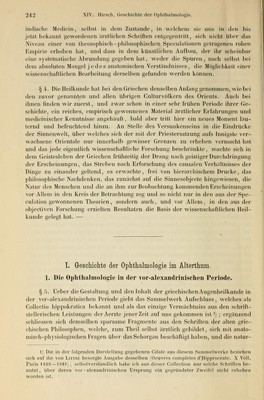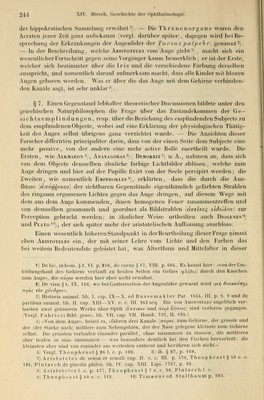Licence: Public Domain Mark
Credit: Geschichte der Augenheilkunde. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by the Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library at Yale University, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library at Yale University.
22/336 (page 244)
![der bippokratischen Sammlung erwähnt l). — Die Thränenorgane waren den Aerzten jener Zeil ganz unbekannt (vergl. darüber später , dagegen wird beiBe- sprechung der Erkrankungen der Augenlider der Tarsus palpebr. genannt^). — In der Beschreibung, welche Aristoteles vom Auge giebt3 . macht sich ein wesentlicher Fortschritt gegen seine Vorgänger kaum bemerklich; er ist der Erste, welcher sich bestimmter über die Iris und die verschiedene Färbung derselbeb ausspricht, und namentlich darauf aufmerksam macht, dass alle Kinder mit blauen Augen geboren weiden. Was er über die das Auge mit dem Gehirne verbinden- den Kanäle sagt, ist sehr unklar' . §7. Einen Gegenstand lebhafter theoretischer Discussionen bildete unter den griechischen Naturphilosophen die Frage über das Zustandekommen der Ge- sichtsempfindungen, resp. über die Beziehung des empfindenden Subjects zu dem empfundenen Objecto, wobei auf eine Erklärung der physiologischen Thätig- keit des Auges selbst übrigens ganz verzichtet wurde. — Die Ansichten dieser Forscher difl'erirten principaliter darin, dass von dereinen Seite dem Subjecle eine mehr passive, von der andern eine mehr active Rolle zuertheilt wurde. Die Ersten, wie Alkmaeon5), Anaxagobas 6), Demokrit7) u.A., nahmen an, dass sich von dem Objecto demselben ähnliche farbige Lichtbilder ablösen , welche zum Auge dringen und hier auf der Pupille fixirt von der Seele pereipirt werden; die Zweiten, wie namentlich Empedokles8), erklärten, dass die durch die Aus- flüsse (dnoQQOiai) der sichtbaren Gegenstände eigentümlich gefärbten Strahlen des ringsum ergossenen Lichtes gegen das Auge dringen, auf diesem Wege mit dem aus dem Auge kommenden, ihnen homogenen Feuer zusammentreffen und von demselben gesammelt und geordnet als Bildstrahlen (düTlveg elöiuhw) zur Perception gebracht werden; in ähnlicher Weise urtheilten auch Diogenes9] und Plato1), der sich später mehr der aristotelischen Auffassung anschloss. Einen wesentlich höheren Standpunkt in derBeurlheilung dieser Frage nimmt eben Aristoteles ein, der mit seiner Lehre vom Lichte und den Farben das bei weitem Bedeutendste geleistet hat, was Alterthum und Mittelalter in dieser 1) Deloc. inhom. §3, VI. p.2S0, de carne ij 17, VIII. p. 604. Es heisst hier: »von der Um- hüllungshaut des Gehirns verlauft zu beiden Seiten ein Gelass [tpkißes] durch den Knochen /.um Auge«, die nönoi werden hier aber nicht erwähnt. 2) De visu §4, IX. 156, wo beiGauterisation der Augenlider gewarnt wird »/litj ötny.avaijg Tinoq ihr yördqov«. 3) Historia animal. lib. I. cap. IX—X. ed Bussemakler Par. 1854, III. p. S, 9 und de partibus animal. lib. II. cap. XIII—XV. e. c. III. 345 seq. Die von Aristoteles angeblich ver- fassten zwei grösseren Werke über Optik (onnxov und ttsqI otyetos) sind verloren gegangen. Vergl. Fabricii Bibl. graec. lib. VII. cap. VII. llamb. 7i>7, II. 195.) V »Von dem Auge«, heisst es, »führen drei Kanäle (noQOt) zum Gehirne, der grösste und der (der Stärke nach) mittlere zum Neben^chirn, der der Nase gelegene kleinste zum Gehirne selbst. Die grössten verlaufen einander parallel, ohne zusammen zu stossen , die mittleren aber lauten in eins zusammen— was besonders deutlich bei den Fischen hervortritt; die kleinsten aber sind von einander am weitesten entfernt und berühren sich nicht.« S Vergl. Theo ph rast § 26 I. C. p. 106. 6) ib. § 27, p. \ 08. 7) Aristoteles de sensu et sensili cap. II. e. c. 111. p. 478, Theop hrast § 50 e. C. 124, Plutarch de placitis philos. lib. IV. cap. XIII. LipS. 1787, p. 93. s Aristoteles 1. c. p. 477, Theophrast § 7 e. c. 90, Plutarch I. c.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b2101999x_0022.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)