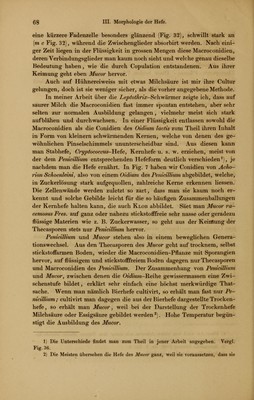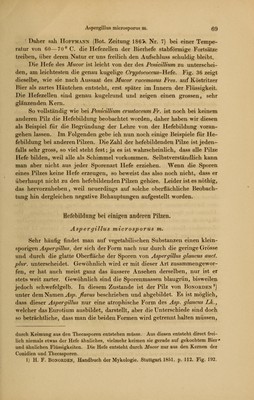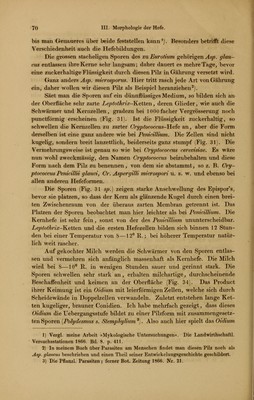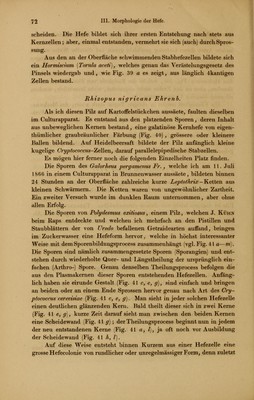Gährungserscheinungen : Untersuchungen über Gährung, Fäulniss und Verwesung, mit Berücksichtigung der Miasmen und Contagien sowie der Desinfection : für Ärzte, Naturforscher, Landwirthe und Techniker / Mitgetheilt von Ernst Hallier ; mit einer Kupfertafel.
- Ernst Hallier
- Date:
- 1867
Licence: Public Domain Mark
Credit: Gährungserscheinungen : Untersuchungen über Gährung, Fäulniss und Verwesung, mit Berücksichtigung der Miasmen und Contagien sowie der Desinfection : für Ärzte, Naturforscher, Landwirthe und Techniker / Mitgetheilt von Ernst Hallier ; mit einer Kupfertafel. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by the Francis A. Countway Library of Medicine, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the Francis A. Countway Library of Medicine, Harvard Medical School.
80/132 (page 68)
![eine kürzere Fadenzelle besonders glänzend (Fig. 32), schwillt stark an [m c Fig. 32), während die Zwischenglieder absorbirt werden. Nach eini- ger Zeit liegen in der Flüssigkeit in grossen Mengen diese Macroconidien, deren Verbindungsglieder man kaum noch sieht und welche genau dieselbe Bedeutung haben, wie die durch Copulation entstandenen. Aus ihrer Keimung geht eben Mucor hervor. Auch auf Hühnereiweiss mit etwas Milchsäure ist mir ihre Cultur gelungen, doch ist sie weniger sicher, als die vorher angegebene Methode. In meiner Arbeit über die Leptothrtx-^chvf'dcrvaQx zeigte ich, dass auf saurer Milch die Macroconidien fast immer spontan entstehen, aber sehr selten zur normalen Ausbildung gelangen, vielmehr meist sich stark aufblähen und durchwachsen. In einer Flüssigkeit entlassen sowohl die Macroconidien als die Conidien des Oidium lactis zum Theil ihren Inhalt in Form von kleinern schwärmenden Kernen, welche von denen des ge- wöhnlichen Pinselschimmels ununterscheidbar sind. Aus diesen kann man Stabhefe, Cryptococcus-Hefe, Kernhefe u. s. w. erziehen, meist von der dem Penicillium entsprechenden Hefeform deutlich verschieden^), je nachdem man die Hefe ernährt. In Fig. 7 haben wir Conidien von Acho- rion Schoenldni, also von einem Oidium des Penicillium abgebildet, welche, in Zuckerlösung stark aufgequollen, zahlreiche Kerne erkennen Hessen. Die Zellenwände werden zuletzt so zart, dass man sie kaum noch er- kennt und solche Gebilde leicht für die so häufigen Zusammenballungen der Kernhefe halten kann, die auch Klob abbildet. Säet man Mucor ra- cemosus Fres. auf ganz oder nahezu stickstofffreie sehr nasse oder geradezu flüssige Materien wie z. B. Zuckerwasser, so geht aus der Keimung der Thecasporen stets nur Peiiicillium hervor. Penicillium und Mucor stehen also in einem beweglichen Genera- tionswechsel. Aus den Thecasporen des Mucor geht auf trocknem, selbst stickstoffarmen Boden, wieder die Macroconidien-Pflanze mit Sporangien hervor, auf flüssigem und stickstofffreiem Boden dagegen nur Thecasporen und Macroconidien des Penicillium. Der Zusammenhang von Penicillium und Mucor, zwischen denen die Oidium-Kei\iG gewissermassen eine Zwi- schenstufe bildet, erklärt sehr einfach eine höchst merkwürdige That- sache. Wenn man nämlich Bierhefe cultivirt, so erhält man fast nur Pe- nicillium ; cultivirt man dagegen die aus der Bierhefe dargestellte Trocken- hefe, so erhält man Mucor ^ weil bei der Darstellung der Trockenhefe Milchsäure oder Essigsäure gebildet werden '^]. Hohe Temperatur begün- stigt die Ausbildung des Mucor. 1) Die Unterschiede findet man zum Theil in jener Arbeit angegeben. Vergl. Fig. 36. 2) Die Meisten übersehen die Hefe des Mucor ganz, weil sie voraussetzen, dass sie](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21056596_0080.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)