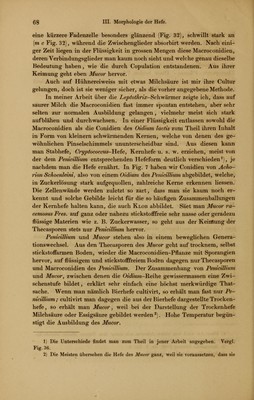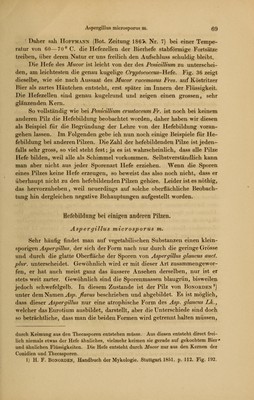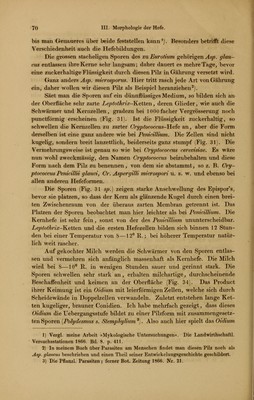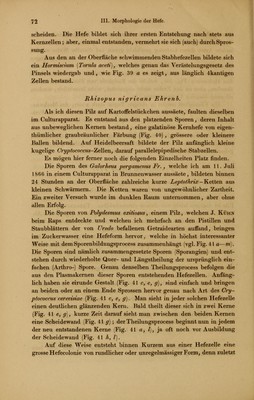Gährungserscheinungen : Untersuchungen über Gährung, Fäulniss und Verwesung, mit Berücksichtigung der Miasmen und Contagien sowie der Desinfection : für Ärzte, Naturforscher, Landwirthe und Techniker / Mitgetheilt von Ernst Hallier ; mit einer Kupfertafel.
- Ernst Hallier
- Date:
- 1867
Licence: Public Domain Mark
Credit: Gährungserscheinungen : Untersuchungen über Gährung, Fäulniss und Verwesung, mit Berücksichtigung der Miasmen und Contagien sowie der Desinfection : für Ärzte, Naturforscher, Landwirthe und Techniker / Mitgetheilt von Ernst Hallier ; mit einer Kupfertafel. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by the Francis A. Countway Library of Medicine, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the Francis A. Countway Library of Medicine, Harvard Medical School.
84/132 (page 72)
![scheiden. Die Hefe bildet sich ihrer ersten Entstehung nach stets aus Kernzellen; aber, einmal entstanden, vermehrt sie sich (auch) durch Spros- sung. Aus den an der Oberfläche schwimmenden Stabhefezellen bildete sich ein Hormiscium (Torula aceti), welches genau das Verästelungsgesetz des Pinsels wiedergab und, wie Fig. 39 a es zeigt, aus länglich 4kantigen Zellen bestand. Rhizopus nigricans Ehrenh. Als ich diesen Pilz auf KartofFelstückchen aussäete, faulten dieselben im Culturapparat. Es entstand aus den platzenden Sporen, deren Inhalt aus unbeweglichen Kernen bestand, eine galatinöse Kernhefe von eigen- thümlicher graubräunlicher Färbung (Fig. 40) , grössere oder kleinere Ballen bildend. Auf Heidelbeersaft bildete der Pilz anfänglich kleine kugelige Cryptococcus-TäeWQji, darauf parallelepipedische Stabzellen. Es mögen hier femer noch die folgenden Einzelheiten Platz finden. Die Sporen des Galorheus pergamentis Fr., welche ich am 11. Juli 1866 in einem Culturapparat in Brunnenwasser aussäete, bildeten binnen 24 Stunden an der Oberfläche zahlreiche kurze Leptofhrix-J^etten aus kleinen Schwärmern. Die Ketten waren von ungewöhnlicher Zartheit. Ein zweiter Versuch wurde im dunklen Raum unternommen, aber ohne allen Erfolg. Die Sporen von Polydesmus exitiosus, einem Pilz, welchen J. Kühn beim Raps entdeckte und welchen ich mehrfach an den Pistillen und Staubblättern der von Uredo befallenen Getraidearten auffand, bringen im Zuckerwasser eine Hefeform hervor, welche in höchst interessanter Weise mit dem Sporenbildungsprocess zusammenhängt (vgl. Fig. 41 a—m). Die Sporen sind nämlich zusammengesetzte Sporen (Sporangien) und ent- stehen durch wiederholte Quer- und Längstheilung der ursprünglich ein- fachen (Arthro-) Spore. Genau denselben Theilungsprocess befolgen die aus den Plasmakernen dieser Sporen entstehenden Hefezellen. Anfäng- lich haben sie eirunde Gestalt (Fig. 41 c, e, g], sind einfach und bringen an beiden oder an einem Ende Sprossen hervor genau nach Art des Crg- ptococcus cerevisiae (Fig. 41 c, e, y). Man sieht in jeder solchen Hefezelle einen deutlichen glänzenden Kern. Bald theilt dieser sich in zwei Kerne (Fig. M e, g], kurze Zeit darauf sieht man zwischen den beiden Kernen eine Scheidewand (Fig. 41 y); der Theilungsprocess beginnt nun in jedem der neu entstandenen Kerne (Fig. 41 a, /), ja oft noch vor Ausbildung der Scheidewand (Fig. 41 A, /). Auf diese Weise entsteht binnen Kurzem aus einer Hefezelle eine grosse Hefecolonie von rundlicher oder unregelmässiger Form, denn zuletzt](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21056596_0084.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)